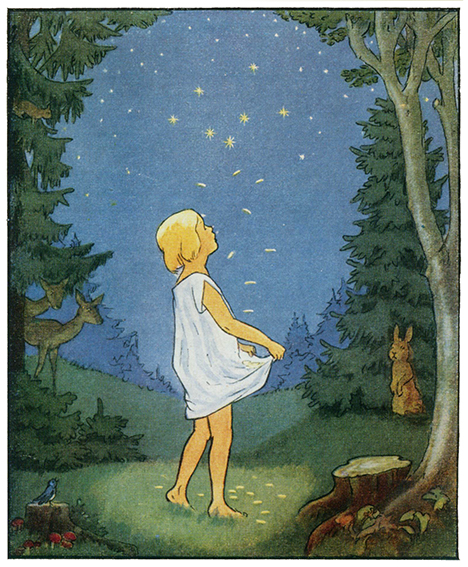Amor und Psyche
Die Erzählung von Amor und Psyche ist Teil des Romans Metamorphosen (auch Der goldene Esel) von Lucius Apuleius (* um 123, † um 170). Das Wort Metamorphosen bedeutet »Verwandlungen« — die Handlung des Romans wird also immer wieder durch fantastische Sprünge vorangetrieben, wie sie für unsere neuzeitlichen Märchen charakteristisch sind. Der Roman als Ganzes ist jedoch vielschichtig, kunstvoll verschachtelt und verwoben, und lässt konkurrierende Deutungsansätze zu. Der Erzählton wie auch die überraschenden Wendungen verleihen dem Ganzen parodistische Züge, wodurch der Roman auch auf heutige Leser erstaunlich frisch und modern, vor allem aber: unterhaltsam, wirkt. Dies war auch die Absicht des Autors, der in der Einleitung warnt: »Leser, pass auf: du wirst dich amüsieren!« Stilistisch hatte der Roman großen Einfluss, der unter anderem in Boccaccios Decamerone, in Schelmenromanen (Don Quijote, Simplicissimus) sowie in modernen Märchen(parodien) sichtbar wird.
Der Roman ist in elf Kapiteln (»Büchern«) aufgebaut. Die äußere Rahmenhandlung dreht sich um die Abenteuer des Erzählers Lucius, der (als Strafe für seine Neugier) in einen Esel verwandelt wird und erst nach langer Irrfahrt am Ende wieder seine menschliche Gestalt zurück erhält. Die Geschichte vom Göttersohn Amor und der sterblichen Königstochter Psyche beginnt am Ende des vierten und endet am Anfang des sechsten Buches und bildet somit das Zentrum des Romans. Am Ende des Romans offenbart sich, dass diese Kernerzählung gewissermaßen die Rahmenerzählung spiegelt, wobei das Schicksal Psyches der Irrfahrt des Lucius entspricht. Das Grundmuster finden wir zum Beispiel in Grimms Märchen Das singende, springende Löweneckerchen: ein schönes, junges Mädchen wird aufgrund einer schicksalhaften Verstrickung mit einem Untier verheiratet, führt dann mit diesem eine entgegen der Erwartung harmonische Beziehung, die aber nicht öffentlich ist. Ein Tabubruch seitens der Frau, forciert durch ihre Schwestern, führt zur Trennung des Paares just in dem Moment, in dem die Frau die wahre Gestalt ihres Gatten erkennt. Nach einer langen, beschwerlichen Suche und dem Bestehen übermenschlicher Prüfungen findet die Frau ihn wieder. Die Beziehung wird erneuert und legitimiert.
Inhalt
Ein Königspaar hat drei schöne Töchter, wobei die Schönheit der Jüngsten die aller Sterblichen übertrifft. Ihr Name ist Psyche, und sie wird von Untertanen und von Fremden wie eine Göttin verehrt. Das Gerücht macht die Runde, eine neue Göttin sei, wie einst Aphrodite (Venus), aus Schaum geboren. Die alten Tempel werden vernachlässigt, während zu Ehren Psyches Feste gefeiert, Opfer gebracht werden und Blumen gestreut werden. Dies erzürnt die echte Venus. Die eifersüchtige Göttin beauftragt ihren Sohn Amor (Cupido), den Experten für Verkupplungen, dafür zu sorgen, dass sich Psyche in den geringsten und am wenigsten geachteten Mann verliebt.
![Burne-Jones_Psyche-wedding]()
Edward Burne-Jones, Psyche’s wedding, 1895
Indes leidet Psyche wegen ihrer Schönheit. Denn die ihr entgegengebrachte Bewunderung macht sie unnahbar. Während ihre älteren, mit eher mittelmäßiger Schönheit ausgestatteten Schwestern längst das Glück und den Status verheirateter Frauen genießen, hält kein einziger Mann um Psyches Hand an. Der Vater ist deswegen ratlos und befragt das Orakel des Gottes Apoll. Die Antwort des Orakels verheißt nichts Gutes für Psyche. Der Vater soll sie »zur Hochzeit wie zur Leiche geschmückt« auf einen bestimmten Berggipfel führen; dort würde sie, da kein Sterblicher bereit ist, sie zu heiraten, von einem geflügelten, grausamen und mächtigen Ungeheuer abgeholt. Die Eltern sind tief betrübt, doch das Orakel duldet keinen Widerspruch.
![Bouguereau-AmorPsyche]()
William Adolphe Bouguereau. The abduction of Psyche, 1895
Psyche wird auf den Berg gebracht und schließlich allein dort zurückgelassen. Das Schlimmste erwartend, fühlt sie sich plötzlich sanft emporgehoben. Ebenso sanft längt sie der unsichtbare Retter auf einer Wiese in einem lieblichen Tal ab, wo sie einschläft. Als sie wieder aufwacht, sie sie vor sich einen märchenhaft schönen Palast. Sie betritt den Palast und sieht sich überall mit immer größerem Staunen um. Erstaunlich ist außer der Pracht auch der Umstand, das nichts von all den Kostbarkeiten verschlossen ist. Außerdem ist nirgendwo eine Menschenseele zu sehen. Als sich Psyche dessen bewusst wird, sagt eine körperlose Stimme zu ihr, sie sei die Herrin des Palastes und solle nun ins Schlafzimmer gehen, um sich auszuruhen. Im Bad wie bei Tisch wird sie von unsichtbaren Dienerinnen umsorgt.
Als es Nacht wird, sorgt sie sich um ihre Unschuld, wobei sie selbst nicht genau weiß, worum genau sie sich sorgt. Tatsächlich kommt ein Unbekannter zu ihr ins Bett und schläft mit ihr, doch sie kann sein Gesicht nicht sehen. Es ist Amor, der sich in Psyche verliebt hat, und sie deshalb von Zephyr, dem Herrn der Winde in seinen Palast bringen ließ, anstatt sie gemäß dem Wunsch seiner Mutter dem Ungeheuer als Braut zuzuführen. Amor kommt von nun an jede Nacht in Psyches Schlafgemach. Hatte sie sich anfangs noch geängstigt, findet sie zunehmend Gefallen an dieser Ehe, obwohl sie ihren Mann nie zu sehen bekommt, sondern ihn nur fühlt und hört. Doch das Glück ist nicht von Dauer. Amor gestattet Psyche, ihre Schwestern besuchsweise zu empfangen, obwohl er kein gutes Gefühl dabei hat. Er warnt sie, nicht auf die Schwestern zu hören, die versuchen würden sie zu überreden, heimlich einen Blick auf den Mann zu erhaschen, der jede Nacht bei ihr liegt. Würde sie diesem Drängen nachgeben, dann würde sie großes Uglück über sie beide bringen. Doch Psyche hört nicht auf Amors Warnung. Die Schwestern haben ihr wesgemacht, ihr Gatte sei eine Schlange und würde sie, die inzwischen schwanger ist, verschlingen. Verstört bricht Psyche das Versprechen, das sie ihrem Mann gegeben hat, und betrachtet ihn im Licht einer Öllampe, ein Messer in der Hand, um nötigenfalls die Schlange zu töten. Doch was sie sieht, ist keine Schlange, wie befürchtet, sondern ein überaus schöner Mann mit Flügeln. Sie begreift, dass sie mit Amor selbst, dem Gott der Liebe, verheiratet ist. Psyche ist so überwältigt, dass sie die Öllampe vergisst. So kommt es, dass ein heißer Öltropfen auf Amors Schulter tropft wovon er erwacht.
Amor, der für Psyche seine Mutter Venus betrogen hat, sieht sich nun selbst betrogen und fliegt davon. Nun erfährt auch Venus von der heimlichen Liebschaft ihres Sohnes, noch dazu mit der schlimmsten Frau von allen, die sterbliche Psyche, die ihr in Sachen Schönheit Konkurrenz macht. Venus ist außer sich vor Wut und befindet in dieser Verfassung, dass ihr Sohn Amor im Grunde schon immer ein Taugenichst und Troublemaker war. So gestimmt, trifft sie die Göttinnen Ceres Göttin des Ackerbaus und der Fruchtbarkeit) und Juno (Göttin der Geburt), die sei zu besänftigen suchen und ihr zu bedenken geben, dass Amor nun mal ein junger Mann und überdies ihr Sohn ist.
Indessen irrt Psyche in der Welt umher und sucht ihren Mann, ohne zu wissen, wie sehr sie die rachsüchtige Venus fürchten muss. Ceres und Juno, die sie um Hilfe bittet, weisen sie ab, das sie sich Venus loyal verbunden fühlen. Der Götterbote Merkur verbreitet im Auftrag von Venus überall die Kunde von der nichstwürdigen Psyche, um sie schnellstmöglich herbeizuschaffen. Inzwischen hat Psyche jedoch beschlossen, sich freiwillig zu ihrer Feindin und Schwiegermutter zu begeben und sie um Vergebung zu bitten. Die Begegnung zwischen den beiden ungleichen Frauen ist erwartungsgemäß schlimm. Zu allem Groll, den Venus ohnehin gegen Psyche hegt, kommt hinzu, dass diese offenbar schwanger ist. Um sie zu demütigem stellt sie Psyche eine unlösbare Aufgabe: sie schüttet Weizen, Gerste, Hirse, Mohn, Erbsen, Linsen und Bohnen durcheinander auf einen großen Haufen und verlangt von Psyche, bis zum Abend alles in geterennte Häufchen zu sortieren. Psyche weint. Einzige Zeugin ist eine Ameise, die großes Mitleid mit der Frau eines Gottes empfidet. Sie ruft ihre Gefährtinnen und erledigt die Aufgabe im Handumdrehn. Venus ist nicht besänftigt, sondern wird nur noch wütender. Sie stellt Psyche eine neue, unlösbare Aufgabe: sie soll von einer in der Ferne weidenden Schafherde ein Flöckchen Wolle holen. Psyche zieht los, allerdings in der Absicht, sich in den Fluss zu stürzen und allem Leid ein Ende zu setzen. Doch das Schilfrohr bittet sie, den Fluss nicht durch eine solche Tat zu entweihen und sich selbst zu schonen. Es gibt Psyche einen Rat, wie sie an die begehrte Wolle kommen kann. Psyche bringt Venus die Wolle, doch die ist noch immer nicht gnädig gestimmt. Als dritte Prüfung erlegt sie ihr auf, Wasser aus einer zwischen steilen Bergen liegenden, unzugänglichen Quelle zu bringen. Hier greift Jupiter ein um zu helfen und schickt einen Adler, der hinabfliegt und Psyches Krug füllt. Nachdem zu Venus’ Erstaunen auch die dritte Aufgabe gelöst ist, sinnt sie nur noch auf Psyches Verderben.
Die vierte Aufgabe, das erkennt auch Psyche nur allzu deutlich, hat den einzigen Zweck, sie für immer loszuwerden. Venus schickt sie in die Unterwelt (den Orkus), um von Prosperina (griechisch Persephone) eine Büchse Schönheitssalbe zu holen. Psyche beschließt, sich von einem hohen Turm zu stürzen, denn dies scheint ihr der kürzeste Weg zu sein, um in die Unterwelt zu gelangen. Doch der Turm beugt sich zu ihr herab und beschreibt ihr genauestens, wie sie sicher die Unterwelt gelangt und — vor allem — auch sicher wieder zurück. Zu den wichtigsten Ratschlägen des Turms gehört der, die Büchse mit der Schönheitssalbe der Prosperina keinesfalls zu öffnen.
Psyche tut, was der weitschauende Turm ihr geraten. Doch als sie nach vielerlei Abenteuern die Unterwelt wieder verlassen hat, kann sie der Versuchung nicht widerstehen, von der Salbe zu probieren, die, wie sie annimmt, göttliche Schönheit verleiht. Sofort fällt sie in einen tiefen Schlaf, den Schlaf des Todes. Zum Glück ist Amor inzwischen von seiner Wunde genesen. Er findet seine Psyche und weckt sie mit einem seiner Pfeile. Sie schickt er zu seiner Mutter, um ihre Anweisung zu befolgen und die Salbe abzuliefern. Er selbst aber begibt sich zu Jupiter (Zeus), da es offensichtlich höherer Mächte bedarf, um seine Mutter Venus zu besänftigen. Jupiter vermählt nun Amor und Psyche in aller Form, und damit endlich auch die Mutter einverstanden ist, reicht er Psyche den Becher der Unsterblichkeit. Damit ist der Makel, dass Amor sich mit einer Sterblichen verbunden hat, aufgehoben. Kurz darauf werden bringt die unsterbliche Psyche ihre und Amors Tochter zur Welt, die sie Voluptas (Vergnügen oder auch Wolllust) nennen.